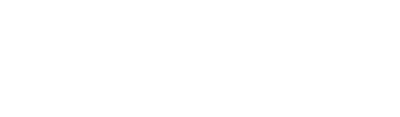Projekt Kitzmarkierung NRW geht in die nächste Runde
Die jährliche Kitzrettung durch Jägerinnen und Jäger in NRW erfolgt heute oft mithilfe von Drohnen- und Wärmebild-Technik. In einem Projekt der Kreisjägerschaft Gütersloh und der Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildtiermanagement (FJW) werden gerettete Kitze markiert, um mehr über unsere Rehe zu erfahren.
Die erste Phase des Projektes endet 2025, daher erfolgte nun eine erste Auswertung – das Projekt soll weitergeführt werden. Kitze werden durch Ricken bevorzugt im dichten Gras von Wiesen abgelegt, bei Annäherung von Gefahr verharren sie instinktiv an Ort und Stelle (Duck-Reflex). Dies führt während der Grünlandernte häufig zu erheblichen Verletzungen oder gar zum Tod der Kitze durch das Mähwerk. Um dieses Tierleid zu vermeiden, ist eine rechtzeitige Kitzrettung erforderlich, basierend auf dem Tierschutzgesetz (§ 1 TierSchG), wonach das Zufügen von Schmerzen, Leiden oder Schäden ohne vernünftigen Grund untersagt ist. Eine Unterlassung dieser Vorsorge kann eine Straftat (§ 17 TierSchG) darstellen.
Methoden der Kitzrettung
Die Kitzrettung erfolgt durch verschiedene Maßnahmen, u. a.:
Mähen von innen nach außen: Gem.Landesnaturschutzgesetz NRW (§ 4 Abs. 1) ist es bei der Mahd auf Grünlandflächen ab 1 ha verboten, von außen nach innen zu mähen.
Absuchen der Wiesen mit Jagdhunden
Scheucheneinsatz mechanisch und akustisch
Drohnen mit Wärmebildkameras
Der zunehmende Einsatz von Drohnen durch Jäger ermöglicht eine effiziente Rettung. Die zuständigen Ministerien (Land und Bund) haben in den letzten Jahren die Beschaffung von Drohnen mit Wärmebildkameras in vielen Kreisjägerschaften finanziell gefördert.
Ziel und Methode der Kitzmarkierung
2020 starteten die Kreisjägerschaft Gütersloh und die FJW ein Projekt, um durch die Kitzrettung zusätzlich einen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten. Die KJS Gütersloh rettet bereits seit mehreren Jahren Kitze mit Drohnen- und Wärmebildtechnik. Über die Markierung so geretteter Kitze mit Ohrmarken erfolgte eine individuelle Zuordnung. Neben der Dokumentation der Setzzeitpunkte konnten über die Meldung markierter Rehe zudem Informationen zu Alters- und Geschlechtsstruktur, Abwanderverhalten und Todesursachen der lokalen Population gewonnen werden.
Rechtliche Aspekte der Kitz-Markierung
Die Markierung von Kitzen zu Forschungszwecken fällt unter das Tierschutzgesetz (§ 7 Art. 2) und wird in NRW durch die zuständige Behörde derzeit als Tierversuch eingestuft. Dies erfordert eine wissenschaftliche Begründung sowie eine Genehmigung durch eine unabhängige Tierschutzkommission. Faktoren wie Belastung der Tiere, Qualifikationen der beteiligten Personen sowie Abbruchkriterien müssen sorgfältig dokumentiert werden. Die FJW führt dazu unter anderem Schulungen mit Theorie-Inhalten (Versuchshintergrund, Tierschutz, Hygiene) und praktische Schulungen vor Ort zum Üben des Einziehens von Ohrmarken durch.
Erste Projektergebnisse
Von 2021 bis 2024 wurden durch die beteiligten Hegeringe der KJS Gütersloh (Versmold, Halle und Harsewinkel) insgesamt 359 Kitze markiert, die Altersverteilung bei der Markierung zeigte, dass sie im Schnitt sechs Tage alt waren. Bis zum 20. Januar 2025 wurden 39 Rehe (11 %) zurückgemeldet. Diese ersten Rückmeldungen ergaben: 90 % der markierten Kitze überleben mindestens die erste Woche nach der Markierung, 64 % der markierten Kitze überleben mindestens ein Jahr. Detaillierte Analysen zur Todesursache und Abwanderungsdistanz sind Teil der laufenden Forschung. Von den 359 markierten Kitzen wurden 119 als männlich, 223 als weiblich und 17 mit unbekanntem Geschlecht angesprochen. Die Zahl markierter Kitze variiert zwischen den Jahren – von nur 63 (2021) bis 115 (2022). Dies kann u. a. auf die Zahl der Helfer sowie auf die Witterungsverhältnisse und daran gebundene Mahd-Termine zurückgeführt werden. Häufigste Todesursache markierter Rehe waren Verkehrsunfälle (19), gefolgt von Erlegung (12), Mähtod (4) und sonstiges Fallwild (n = 4/ohne Verkehrsopfer). Verkehrsverluste traten in allen Alters-gruppen (0 -3 / 3 -6 / 6 -12 / 12 -24 und über 24 Monate) auf. Ebenso wurden Rehe aller Altersklassen erlegt. Vermähen als Todesursache trat v. a. in sehr kurzer Zeit nach der Markierung (innerhalb der ersten 15 Tage) auf. Der größte Abstand zwischen Fund und Wiederfund lag bei Tieren, die erlegt wurden (Mittelwert 275 Tage) – zum Vergleich: Fund als sonstiges Fallwild (90) und Verkehrsunfall (269 Tage). Von 39 zurückgemeldeten Rehen liegen für 37 gültige Fund- und Wiederfund-Koordinaten vor. Daraus lässt sich die Abwanderungsdistanz berechnen. Sie liegt zwischen 0 und 5 149 m (Durchschnitt 699 / Mittelwert 316 m) und war bei Rehen, die Verkehrsunfällen zum Opfer fielen, am höchsten (Mittel 470 m). Rehe, die man als Fallwild fand oder die erlegt wurden, wiesen die kürzeste Distanz zwischen Fund- und Wiederfund-Ort auf (durchschn. 196 m). Weibliche Tiere (22/Mittel 356 m) wanderten weiter ab als männliche (13/183 m).
Herausforderungen und Ausblick
Für eine langfristige wissenschaftliche Aussagekraft müssen die Akteure vor Ort dauerhaft in das Projekt eingebunden bleiben. Die Akzeptanz und Beteiligung von Jägern, Landwirtschaft, Naturschutzverbänden und a. Interessengruppen ist essenziell. Ebenso wichtig ist der Informationsfluss hinsichtlich der Rückmeldungen zwischen den Beteiligten – Forschungsstelle, Auffangstationen, Polizei und angrenzende Kreisjägerschaften. Ein neuer Tierversuchsantrag soll im Sommer 2025 (Saison ab Frühjahr 2026) gestellt werden, um das Projekt weiter auszubauen und belastbare Daten zu gewinnen. Wir rufen daher auch weitere interessierte Kitzrettungsteams auf, sich bei der Forschungsstelle zu melden, wenn sie aktiver Teil des Projektes werden möchten und bitten um Rückmeldung per Mail bis zum 30. Juni (Stichwort Rehkitzrettung) an fjw@lave.nrw.de.
Bitte nennen Sie dabei unbedingt die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechperson(en) und erläutern kurz Ihre bisherigen Erfahrungen (z. B. hinsichtlich der Zahl der jährlich geretteten Kitze).
Fazit: Kitzmarkierung leistet einen wichtigen Beitrag zu einem tierschutzgerechten Wildtiermanagement. Durch Kombination moderner Technik und wissenschaftlicher Begleitung können langfristig wertvolle Erkenntnisse für den Tier- und Artenschutz sowie die Wildökologie gewonnen werden. Zukünftig könnten Bejagungskonzepte so auf das regionale Rehwildvorkommen abgestimmt werden – v. a. im Hinblick auf Wildunfallverhütung und Populationsmanagement.
Nina Meister & Dr. Luisa Fischer, Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildtiermanagement, Landesamt für Verbraucherschutz und Ernährung NRW