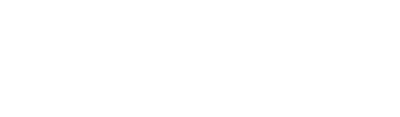Blauzungenkrankheit und EDHV bei Hirschartigen in NRW
Im November 2022 fielen in Spanien zwei Rothirsche mit Atembeschwerden und Schwäche auf, kurze Zeit später wurden sie tot aufgefunden. Die Befunde entsprachen dem, was bei einem akuten Verlauf der Blauzungenkrankheit oft bei Schafen beobachtet wird – Blaufärbung der Schleimhäute und Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge. Es wurde aber die sog. „Epizootische Hämorrhagie“ (EHDV) nachgewiesen – der gleiche Erreger, der Monate zuvor bereits in Italien (Sizilien/Sardinien) und Tunesien kursierte.
Sowohl EHDV als auch Blauzungen-Viren (BTV) lösen eine Schädigung des Gefäßsystems und der Schleimhäute aus, bei den Symptomen sind sich beide Infektionen deshalb zum Verwechseln ähnlich –Fieber, Schwäche, Appetitlosigkeit, innere Blutungen (Hämorrhagien), Ödeme (Wasseransammlungen im Gewebe), Blaufärbung der Zunge, Geschwüre im Maul und an den Klauen, die vermehrtes Speicheln bzw. Lahmheit auslösen können. Eine eindeutige Unterscheidung gelingt nur durch eine virologische Diagnostik. Beide Erreger gehören zu den Orbiviren und zählen in Deutschland zu anzeigepflichtigen Tierseuchen, bei denen bereits ein Verdacht ans zuständige Veterinäramt gemeldet werden muss. Sie werden hauptsächlich von blutsaugenden Stechinsekten (v. a. Gnitzen) übertragen und infizieren ausschließlich Wiederkäuer. Beim BTV zeigen besonders Schafartige schwere Verläufe, beim EHDV vorwiegend Rinderartige und Geweihträger. Schwerwiegende Infektionen treten häufiger in Populationen auf, die noch keinen Kontakt mit den Erregern hatten und folglich keine Immunabwehr aufbauen konnten. Nach einer BTV-Infektion besteht kein Schutz gegen EHDV, auch nicht im umgekehrten Fall (keine sog. Kreuz-Immunität). In den USA wurde EHDV 1955 bei Weißwedelhirschen entdeckt, infiziert dort aber regelmäßig auch andere Wildwiederkäuer wie Maultierhirsche, Bisons und Gabelbockantilopen. Das Virus war lange auf Amerika, Afrika, Asien und Australien beschränkt, doch seit 2022 breitet sich in Europa der Serotyp 8 rasch von Süden nach Nordosten aus. Erste Fälle meldeten Italien und Spanien, bald darauf Portugal, Frankreich und zuletzt Belgien (April 2025/dabei handelte es sich um ein gegen EHD geimpftes Rind, das aus Frankreich nach Belgien verbracht wurde). Allein in Frankreich wurden von Juni 24 bis März 25 über 3 800 Ausbrüche v. a. bei Rindern registriert.
Lage in Deutschland
Anders als EHDV ist BTV in Deutschland bereits seit 2006 bekannt, damals waren hauptsächlich die Serotypen 4 und 8 verbreitet. Im Oktober 2023 wurde eine neue Variante (Serotyp 3) festgestellt und führte zwischen Mai 2024 und Mai 2025 zu mehr als 17 000 amtlich bestätigten Fällen bei Haus- und Wildtieren. Laut Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) wurden allein in NRW rund 3 560 Fälle, aber nur 28 bei Muffel-, Dam-, Reh- und Rotwild nachgewiesen. Es ist vermutlich allein eine Frage der Zeit, wann auch EHDV in Deutschland ankommt, die Entfernung zu den nächstgelegenen Fällen in Frankreich beträgt ganze 370 km. Ursächlich für die schnelle und teilweise sprunghafte Ausbreitung ist der Handel mit unerkannt infizierten Tieren und die Windverdriftung infizierter Gnitzen. Diese sind zwar schlechte Flieger, können aber über den Wind viele Kilometer weit getragen werden. Dieser Verbreitungsweg erwies sich schon bei BTV als erfolgreich. Bedingt durch die Klimakrise finden diese Stechinsekten in unseren Gefilden und zunehmend auch weiter nördlich immer bessere Lebensbedingungen. Ihre Aktivitäts- und Fortpflanzungszeiträume erweitern sich durch die milderen Temperaturen in Frühjahr und Herbst – und damit auch das Übertragungsrisiko – das FLI stuft die Wahrscheinlichkeit einer Verschleppung durch Windverdriftung gerade von Mai bis Oktober als hoch ein. Ob und inwiefern abwandernde Wildwiederkäuer als sogenannte stille Träger (ohne Symptome, aber mit Virus im Körper) zur Ausbreitung beitragen, ist noch unbekannt, eine systematische Überwachung (für BTV bereits etabliert) wird auch für EHDV nötig werden. Deshalb ist EHDV für Jägerinnen und Jäger mehr als nur ein Thema am Rande. Sie können durch die genaue Beobachtung des Bestandes (etwa bei vermehrten Todesfällen bei Hirschartigen) den Verdacht an die Veterinärämter melden und so als Früherkennungssystem fungieren. Einmal im Wildbestand etabliert, kann EHD wie in den USA mitunter erhebliche Wildverluste verursachen. In Europa sind bisher v. a. Rinder betroffen, doch es wurden bereits schwere Verläufe etwa bei Rotwild dokumentiert.
Impfung nur bei Haustieren
Die Behandlungsoptionen sind bei beiden Erkrankungen sehr begrenzt. Betroffene Länder in Europa sind verpflichtet, Überwachungsmaßnahmen durchzuführen, um die räumliche und zeitliche Entwicklung der beiden Seuchen zu verfolgen. Daher wird bereits jetzt Fallwild (Wildwiederkäuer) bei Verdacht entsprechend untersucht. Eine Impfung gehaltener Wiederkäuer (so die ständige Impfkommission Veterinärmedizin) ist derzeit der einzige effektive Schutz vor schweren Verläufen und einer Ausbreitung. Die gute Nachricht – für BTV existieren mehrere zugelassene serotyp-spezifische Impfstoffe, auch gegen EHDV 8 gibt es seit März 2025 in der EU einen zugelassenen Impfstoff, der bereits in Frankreich und Belgien eingesetzt wird.
Was Jäger wissen sollten
Informieren Sie sich regelmäßig zur Ausbruchslage der Blauzungenkrankheit und EDHV bei Hirschartigen (Rot-, Dam- und Sikawild). Achten Sie auf auffälliges Verhalten bzw. vermehrte Fallwildfunde bei Wildwiederkäuern und geben Sie diese zur Fallwilduntersuchung bzw. melden Sie begründete Verdachtsfälle umgehend an Ihr zuständiges Veterinäramt. Um Ausbrüche früh zu entdecken und einen Überblick der Infektionslage bei Wildwiederkäuern in NRW zu erlangen, bitten wir hier im RWJ darum, verendete oder krank erlegte Wildwiederkäuer im Rahmen des Fallwildmonitorings den CVUÄ in Arnsberg, Detmold, Krefeld oder Münster zukommen zu lassen. Die Kosten dafür werden von der FJW getragen. Berit Gerstel, Dr. Luisa Fischer, Dr. Nico Reinhardt