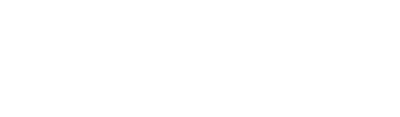NRW-Jagdjahr 2024/25: Niederwild auf Talfahrt
Trotz besonderer Herausforderungen haben die Jäger in NRW im zurückliegenden Jagdjahr ihre Hausaufgaben gemacht. Besorgniserregend sind die Strecken-Zahlen beim Niederwild.
Die prägenden klimatischen Veränderungen der letzten Jahre und die aktuellen seuchenhaften Krankheitsgeschehen zählen zu den Rahmenbedingungen, die auch Jagdstrecken wesentlich beeinflussen. Fallwildzahlen können wertvolle Hinweise auf mögliche Krankheitsgeschehen bzw. deren Auswirkungen liefern. Somit ist und bleibt die Erfassung der Jagdstrecken weiterhin ein elementarer Baustein für das Wildtiermanagement und die Beurteilung einer nachhaltigen Nutzung der heimischen Wildbestände.
Im Jagdjahr 2024/2025 waren neue Rekordwerte der Jahresdurchschnittstemperatur und zunehmende Wetterextreme auffällig. Neben den unmittelbaren Einflüssen auf das heimische Wild, beispielsweise auf die witterungsbedingte Überlebensrate von Jungwild, gibt es unzählige indirekte Folgen, wie die Verlängerung der Wachstumsperiode und Veränderung der Mastjahre bzw. verfrühte Mast, welche besonders den Schwarzwildpopulationen zu Gute kommt, aber auch das Einstands- und Äsungsverhalten von Rotwildbeständen beeinflussen kann.
Im Schalenwildbereich spielen die Kalamitätsflächen besonders für das Rehwild eine dominierende Rolle. Hier erschwert das Wachstum der Kraut- und Strauchschicht, sowie dichte Verjüngung die Sichtbarkeit des Wildes. Auf Flächen ohne entsprechende jagdliche Infrastruktur, wie Jagdschneisen, Äsungsflächen und geschickt platzierte Ansitzmöglichkeiten, ist eine effiziente Bejagung nur eingeschränkt möglich. Eine zielgerichtete, intensive Bejagung auf Wiederaufforstungsflächen verbunden mit entsprechenden Ruhezonen mit Äsungsflächen bleibt dabei der zielführendste Ansatz. So können auch nicht letale Effekte einer Bejagung einen positiven Einfluss auf den Erfolg der Wiederaufforstung von Kalamitätsflächen haben.
Auch klimabedingte, strukturelle Veränderungen auf landwirtschaftlichen Flächen (z. B. vermehrter Anbau von energiereichen Pflanzen wie Hülsenfrüchten) beeinflussen die Überlebenswahrscheinlichkeit verschiedener Wildarten. Zudem kann die Anfälligkeit für Wildschäden bei besonderen Pflanzungen bzw. Kulturen, die eine größere klimatische Toleranz aufweisen bzw. trockenresistenter sind (z. B. Soja) deutlich steigen. Neben qualitativen, oft klimabedingten Veränderungen im Anbau, verändert sich auch die quantitative Verfügbarkeit. Die nahezu ganzjährige Futterverfügbarkeit auf Agrarflächen begünstigt zusätzlich den Zuwachs von Gänsen und Krähen, die eine intensive Bejagung vor allem innerhalb der regulären Jagdzeit bedürfen. Die Hege von Arten wie dem Rebhuhn bleibt eine dringende Daueraufgabe.
Neben der Veränderung der klimatischen Bedingungen, was vor allem das Vorkommen von krankheitsübertragenden Insekten (sog. Vektoren wie Stechmücken, Gnitzen und Zecken) begünstigt, werden neuartige, durch den Menschen eingeschleppte Krankheitserreger immer relevanter. Die im Sommer 2025 nach NRW eingetragene Afrikanische Schweinepest ist dafür ein gutes Beispiel. Der Eintrag einer neuen Variante des Myxomavirus beeinflusste beim Feldhasen wie erwartet die Streckenentwicklung im Jagdjahr 2024/25 erheblich. Die Feldhasenmyxomatose wurde deutschlandweit erstmalig 2024 in Nordrhein-Westfalen festgestellt und ist sicherlich nicht zuletzt durch das bereits lang etablierte Fallwildmonitoring aufgefallen. Die weiteren Entwicklungen der Feldhasenpopulation lassen sich in Gänze erst in den nächsten Jahren abschätzen. Hohe Fallwildzahlen verdeutlichen aber die erheblichen Verluste; umso wichtiger ist dabei eine nachhaltige Bejagung – erst zählen, dann jagen. Viele Revierinhaber setzten diese Verantwortung bereits im vergangenen Jahr um und verzichteten beim Auftreten der Myxomatose im vorhandenen Feldhasenbestand freiwillig auf eine Bejagung.
Schalenwild
Die Rotwildstrecke liegt mit 7 064 Stück um 2,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Dennoch zeigt sich seit dem Jagdjahr 2019/2020 ein stabiler Wert von über 7 000 Stück. Es ist zu erwarten, dass auch das Rotwild von dem anstehenden Waldumbau hin zu einem klimastabilen und artenreichen Wald, profitieren wird. Dennoch bleibt das Management dieser Art v.a. im Hinblick auf deren Populationsgenetik eine Herausforderung.
Beim Sikawild ist nach dem Höchstwert im Vorjahr ein Rückgang um 17,5 Prozent auf 1 871 Stück zu verzeichnen. Auch die Fallwildstrecke ist mit 26,7 Prozent deutlich gesunken. Die Entwicklung der Jagdstrecke wird nach wie vor maßgeblich durch das Bejagungsmanagement im Arnsberger Wald bestimmt.
Die Damwildstrecke ging im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozent auf 5 405 Stück zurück, bewegt sich damit jedoch seit dem Jagdjahr 2019/2020 konstant über der Marke von 5 000 Stück. Damwild ist optimal an die Kulturlandschaft und das Angebot an Äsung und Deckung durch Land- und Forstwirtschaft angepasst.
Beim Muffelwild wird mit 1 706 Stück ein neuer Höchstwert erreicht, der 1,7 Prozent über dem Wert des Vorjahres liegt. Auffällig ist der Anstieg der Fallwildstrecke um 171,4 Prozent, während Verkehrsverluste lediglich 12,3 Prozent ausmachen. Dies ist in Großteilen auf das Auftreten der Blauzungenkrankheit zurückzuführen. Da Schafartige besonders anfällig für den kursierenden Serotyp waren, fielen der Krankheit auch Muffelschafe zum Opfer. Ein Teil der Strecke wird durch Vorkommen erzielt, die außerhalb der klassischen Verbreitungsgebiete liegen. In vielen dieser Gebiete ist die Absenkung bzw. Tilgung der Bestände weiterhin eine Herausforderung.
Die Rehwildstrecke erreicht mit 133 130 Stück ein Allzeithoch, ein Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Anstieg der Rehwildstrecke ist hauptsächlich in Gebieten zu verzeichnen, die durch Borkenkäferbefall definiert wurden. Dies zeigt, dass Rehe von der Waldentwicklung dieser Kalamitätsflächen in den frühen Sukzessionsphasen profitieren, aber auch die Bemühungen der Jägerschaft die Wiederbewaldung durch die Rehwildbejagung innerhalb der regulären Jagdzeit zu unterstützen.
Beim Schwarzwild ist die Strecke nach einem Vorjahresanstieg auf 40 088 Stück im Jagdjahr 2024/2025 um 3,7 Prozent zurückgegangen. Es zeigt aber auch, dass sich die Schwarzwildpopulation, nach dem Einbruch der Jagdstrecke im Jahr 2022/2023 von 29 991 Stücken, deutlich erholt hat. Die Bemühungen der Jägerschaft den Schwarzwildbestand im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest in ganz NRW abzusenken, sollten jedoch auf keinen Fall nachlassen. Starke zyklische Schwankungen in den Jahresstrecken sind zwar typisch für Schwarzwild, mit einer Reproduktionsleistung von bis zu 300 Prozent können die Bestände jedoch bei zurückhaltender Bejagung rasant ansteigen.
Niederwild
Die Feldhasenstrecke ist mit 53 254 Stück im Vergleich zum Vorjahr um 26,8 Prozent drastisch zurückgegangen. Grund hierfür ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Myxomatose beim Feldhasen, welche für zurückhaltende Bejagung, aber auch die um 82,4 Prozent gestiegenen Fallwildzahlen verantwortlich sein könnte. Das Fallwild macht im Jagdjahr 2024/2025 beim Feldhasen 43,9 Prozent der Gesamtstrecke aus.
Auch beim Wildkaninchen hat sich die Strecke um 30,5 Prozent auf 17 202 Stück verringert. Dies folgt dem kontinuierlichen Abnahmetrend seit 2007 und markiert den Tiefpunkt seit den 1960ern. Das Fallwild reduzierte sich um 2,4 Prozent und hat dennoch einen Anteil von 26,8 Prozent an der Gesamtstrecke. Durch Krankheiten wie z. B. Myxomatose oder RHD-Virusvarianten (Rabbit-Haemorrhagic-Disease oder Chinaseuche) werden hohe Verluste verursacht.
Die Dachsstrecke stieg um 3,4 Prozent auf 8 233 Stück und markiert somit den Höchstwert seit den 1960ern. Bei der Bejagung spielt der Abschuss (87,9 Prozent) nachhaltig die wesentlichste Rolle, 12,1 Prozent entfallen auf die Fangjagd. Der Fallwildanteil von 19,9 Prozent geht zu 86,1 Prozent auf den Straßenverkehr zurück.
Die Fuchsstrecke liegt bei 52 372, ein Zuwachs von 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Abzug des Fallwildes entfallen 90,6 Prozent auf Abschüsse, 9,4 Prozent auf Fang- und Baujagd. Eine nachhaltige Fuchsbejagung ist auf die Fangjagd angewiesen. Die Prädatoren-Bejagung kann auch für die Unterstützung lebensraumverbessernder Maßnahmen von großer Bedeutung sein, diese aber nicht ersetzen.
Die Steinmarderstrecke sank leicht um 1,1 Prozent auf 9 707 Stück. Nach Abzug des Fallwildes beträgt der Anteil der Fangjagd 50,9 Prozent, der Abschuss 49,1 Prozent.
Beim Iltis stieg die Strecke auf 3 403 Stück, ein Plus von 8,2 Prozent. Dabei entfallen 51,5 Prozent auf den Abschuss, 48,5 Prozent auf Fangjagd.
Beim Hermelin liegt die Strecke mit 596 Stück um 26 Prozent unter der des Vorjahres. Auch die Fallwildstrecke ist um 18,9 Prozent gesunken. Es kamen 34,4 Prozent durch Abschuss und 65,6 Prozent durch Fangjagd zur Strecke.
Die Waschbärenstrecke stieg erneut um 12,2 Prozent auf 33 672 Stück und folgt damit einem ungebrochen starken Aufwärtstrend. Damit erreicht die Jagdstrecke erneut einen Jahreshöchststand im Vergleich zu den Vorjahren. Durch den Abschuss wird der Großteil des Streckenanteils erzielt (60,2 Prozent), aber auch die Fangjagd spielt weiterhin eine große Rolle (39,8 Prozent). Meist optimale Lebensbedingungen und entsprechend gute Reproduktionsraten können nicht nur Artenschutzziele gefährden, sondern sorgen zunehmend für Konflikte im Siedlungsbereich.
Beim Marderhund ist die Strecke mit 172 Stück um 18,9 Prozent gesunken. Es kamen 64,8 Prozent durch Abschuss und 35,2 Prozent durch Fangjagd zur Strecke. Vor allem durch sein ausgeprägtes Wanderverhalten erschließt sich der Marderhund schnell neue Lebensräume.
Im vergangenen Jagdjahr kamen 15 Minke zur Strecke, davon 13 durch Fangjagd, ein Tier durch Abschuss und eines als Fallwild. Dies entspricht einer Steigerung um 200 Prozent und deutet auf eine Zunahme der Strecke nach dem Rückgang nach 2020/2021 hin. Der Mink gilt als invasive Art und stellt durch seine Lebensweise eine Bedrohung für unsere heimischen Arten dar.
Das Rebhuhn unterliegt zwar dem Jagdrecht, ist jedoch ganzjährig geschont. Es wurden 211 Tiere als Fallwild gemeldet, davon 106 Verkehrsverluste. Auch im Jagdjahr 2024/2025 wurde durch die Jägerschaft viel Hegearbeit geleistet, um das Bestehen dieser Niederwildart zu sichern. Das Bestandsmonitoring des Rebhuhns wird seit mehreren Jahren von Jägerinnen und Jägern gemeinsam mit Ornithologinnen und Ornithologen durchgeführt.
Die Fasanenstrecke liegt bei 35 918 Stück, was einem Rückgang von 16,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Strecke bewegt sich damit weiterhin seit 2013/2014 auf einem niedrigen Niveau. Durch die ausbleibende Feldhasenbejagung im Jagdjahr 2024/2025 könnten auch weniger Fasane zur Strecke gekommen sein.
Mit 134 983 Stück bleibt die Ringeltaube die am häufigsten erlegte Wildart in NordrheinWestfalen, verzeichnet jedoch einen Rückgang um 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr und setzt damit den Abwärtstrend seit 2008/09 fort.
Die Strecke der Höckerschwäne stieg um 7 Prozent auf 200 Stück. Die Fallwildstrecke stieg um 64,9 Prozent. Insgesamt macht Fallwild 30,5 Prozent der Strecke aus.
Bei der Graugans erreicht die Strecke mit einem Anstieg von 8,7 Prozent einen Höchstwert mit 15 150 Tieren. Damit wird der, seit 2006/2007 steigende Trend fortgeführt.
Einen ähnlichen Aufwärtstrend sehen wir bei der Kanadagans. Die Strecke der Kanadagans ist um 11,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 9 854 gestiegen und markiert somit ebenfalls einen Höchstwert.
Auch bei der Nilgans wird mit einer Strecke von 17 164 Stück und einem Anstieg um 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr die bisher höchste Strecke erreicht.
Die Stockentenstrecke ist um 12,8 Prozent auf 50 223 Stück gestiegen.
Die Strecke der Waldschnepfen hat sich mit 2 401 Stück deutlich um 20,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr verringert.
Die Rabenkrähenstrecke liegt mit 94 430 Stück 2,9 Prozent unter der Strecke des Vorjahres. Seit 2019/2020 zeichnet sich ein Rückgang der Strecke ab.
Bei den Elstern wurde mit 21 666 Stück ein neuer Tiefstwert erfasst (-7,9 Prozent). Die Elsternstrecke ist seit 2006 rückläufig. Forschungsstelle für Jagdkunde und Wildtiermanagement